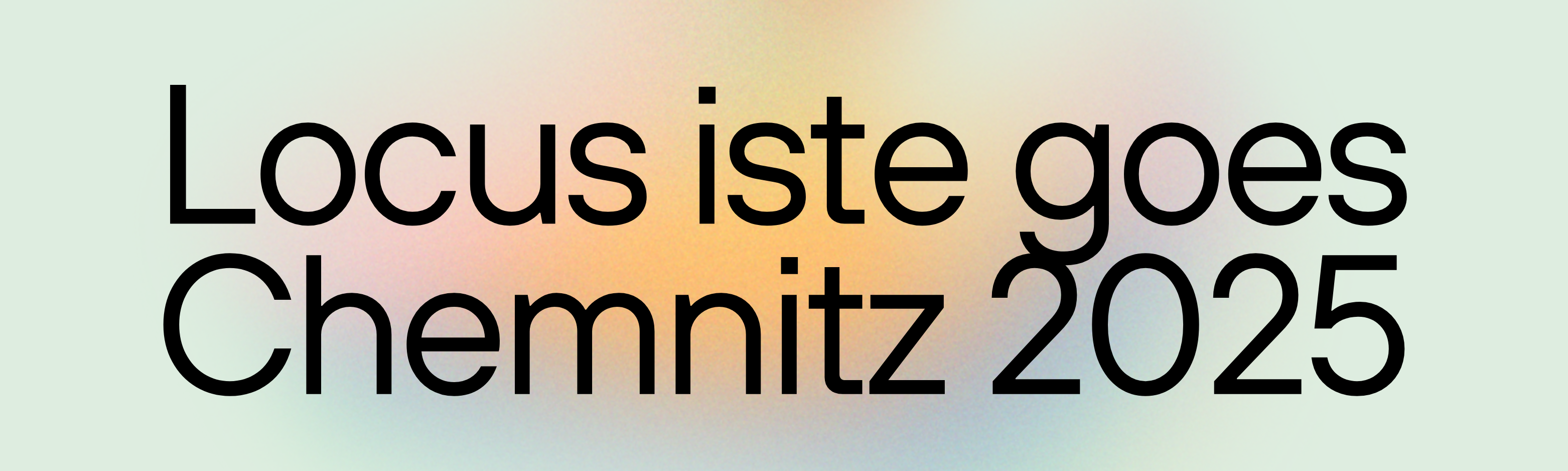Aktuelles
Locus iste goes Chemnitz 2025. Überregionales KuPoGe-Treffen
17.10.-19.10.2025, Zentralbibliothek im TIETZ, Chemnitz
Vor dem Hintergrund des Kulturhauptstadtjahres 2025 rückt die Stadt in den Fokus künstlerischer und kulturpolitischer Aufmerksamkeit – sowohl aufgrund der beeindruckenden Entwicklungen als auch im Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen. „Locus iste goes Chemnitz 2025“ möchte – im Sinne des Selbstverständnisses der KuPoGe als Think-and-Do-Tank – ein konkretes Format erproben. Im Vordergrund steht das von- und miteinander lernen. Darüber hinaus soll das Wochenende in Chemnitz Gelegenheit für Austausch und Vernetzung bieten.
Fishbowl-Diskussion: Boxenstopp Chemnitz
18.10.2025, 18:00 – 20:00 Uhr: Zentralbibliothek im TIETZ, Chemnitz
Derzeit wird die Kulturstrategie der Stadt Chemnitz eng mit dem kürzlich fortgeschriebenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK 2035) abgestimmt. Dieser ressortübergreifende Abgleich ist entscheidend, um kulturelle und stadtentwicklungsbezogene Leitbilder, Maßnahmen und Förderlogiken künftig nachhaltig zu verzahnen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund wurden für die Diskussion gezielt zentrale Akteur*innen aus Kultur und Stadtentwicklung eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter*innen aus Kultur, Stadtentwicklung, Verwaltung, Architektur, Initiativen, Vereinen und interessierte Bürger*innen. Sie ist Teil des überregionalen Treffens „Locus iste goes Chemnitz 2025“ der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mitgliedertreffen der Landesgruppe Sachsen
19.10.2025, ab 12:00 Uhr: Weltecho, Chemnitz
Im Rahmen des überregionalen KuPoGe-Treffens „Locus Iste goes Chemnitz 2025“ findet ein Mitgliedertreffen der Landesgruppe Sachsen statt. Das Treffen bietet Gelegenheit zum Austausch unter Mitgliedern aus Sachsen, zum Besprechen aktueller Themen sowie zum Entwickeln neuer Impulse für die Arbeit in der Landesgruppe. Auch an einer Mitgliedschaft Interessierte sind herzlich willkommen.
Rückblick
Wahlprüfsteine
Die sächsische Landesgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft verschickte im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen 2024 Wahlprüfsteine an die CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, AfD, DIE LINKE, FDP und BSW. Die eingegangenen Antworten stellen wir auf der Webseite der Landesgruppe Sachsen der Kulturpolitischen Gesellschaft frei zur Verfügung. Grundlage für die Fragen an die Parteien waren die zentralen Themen der Kulturpolitischen Gesellschaft in den vergangenen Jahren. Zudem haben wir darauf geachtet, inhaltliche Wiederholungen im Vergleich zu den Wahlprüfsteinen der IG Landeskulturverbände in Sachsen zu vermeiden. Beide Fragenkataloge ergänzen sich somit. Die Resonanz im sächsischen Kulturbereich auf die Wahlprüfsteine war sehr positiv. Die neue Staatsregierung wird sich auch an den Wahlprüfsteinen der KuPoGe messen lassen müssen.
Instagram: @kupoge_sachsen
Wahlprüfsteine Sachsen 2024 angefragt von der Landesgruppe Sachsen der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.
Frage 1: Themenbereich „Inter- und transnationale Kulturpolitik“
-
CDU
Die Kulturförderung des Freistaates Sachsen und auch die Förderung im Rahmen des sächsischen Kulturraumgesetzes bieten vielfältige Möglichkeiten, den internationalen Austausch auf dem Gebiet von Kunst und Kultur zu organisieren und auszugestalten. Mit der Finanzierung unserer staatlichen Kultureinrichtungen sichern wir auch die Möglichkeit des internationalen Austausches und Auftritte sächsischer Ensembles im Ausland. Im Rahmen der Imagekampagne „so geht Sächsisch“ ermöglichen wir auch die Unterstützung weiterer gezielter und hochwertiger Projekte im Bereich des internationalen Kulturaustausches.
-
SPD
m Zuge einer international ausgerichteten Kulturpolitik unterstützt die SPD Sachsen Kulturschaffende und Kultureinrichtungen, in ihrer Arbeit noch stärker in den Austausch und die Kooperation mit internationalen Partnern, insbesondere aus Europa, zu gehen. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die Vernetzung mit unseren Nachbarn Tschechien und Polen.
Die Kulturhauptstadt Europas „Chemnitz 2025“ steht für uns exemplarisch dafür, wie sich internationale Kooperation in Sachsen anfühlen kann. Entsprechend werden wir kulturelle Projekte und Einrichtungen fördern, die die Weltoffenheit und Demokratie in Sachsen beleben und dazu mit internationalen Partner:innen zusammenarbeiten.
Programme, die die internationale Vernetzung der sächsischen Kulturszene und internationalen Austausch zum Ziel haben, führen wir selbstverständlich fort. Hierzu zählen u. a. die Gastspielförderung und internationale Stipendienprogramme der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen oder auch die Förderung des internationalen kulturellen Dialogs.
Um sächsischen Kulturakteuren die Arbeit in europäischen Netzwerken und Kooperationsprojekten generell zu erleichtern, richten wir einen Co-Finanzierungsfonds für EU-Programme wie Kreatives Europa ein.
Wir schätzen es sehr, dass sich viele Kultureinrichtungen des Freistaates Sachsen, wie etwa die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Bereich der Provenienzforschung, aktiv an internationalen Projekten beteiligen oder in internationalen Netzwerken mitarbeiten. Entsprechende Initiativen von staatlichen Einrichtungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit unterstützen wir daher auch in Zukunft. Darüber hinaus werden wir Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsens, z. B. mit der Woiwodschaft Niederschlesien, auch im Kulturbereich weiter mit Leben ausfüllen und bauen dabei neben freien Kulturinitiativen gerade auch auf unsere staatlichen Kultureinrichtungen. -
Bündnis 90/ Die Grünen
Kunst und Kultur sind für uns BÜNDNISGRÜNE ein wichtiges Feld, um die europäische Nachbarschaft zu stärken. Wir wollen die Beziehungen Sachsens insbesondere zu unseren europäischen Nachbarn Polen und Tschechien vertiefen. Mit der Gründung eines Regionalrates wollen wir die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien ausbauen und dabei auch den künstlerischen Austausch und die Zusammenarbeit mit Kulturakteur*innen intensivieren.
Wir wollen die internationalen Residenz- und Austauschprogramme der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen stärken und die Zusammenarbeit sächsischer staatlicher und nicht-staatlicher Kultureinrichtungen mit Akteur*innen in Partnerländern ausbauen, beispielsweise bei internationalen Festivals, Produktionen, Stipendien, Leihgaben und Fachkonferenzen.
Internationale Impulse erachten wir als wichtige Ressource für eine gelingende Entwicklung der sächsischen Kultur in einer diverseren, polarisierten und sich schnell wandelnden Gesellschaft. Nicht zuletzt soll die internationale Kulturpolitik im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas einen besonderen Schub erhalten und auf den gesamten Freistaat ausstrahlen. -
AfD
Eine Maßnahme wird darin bestehen, das Netzwerk der internationalen Partnerschaften – auch und insbesondere im Hinblick auf die kulturelle Zusammenarbeit – zu vertiefen bzw. auszuweiten.
Wir streben den Ausbau bestehender und die Gründung neuer sächsischer Verbindungsbüros an – etwa für Mittel-Ost-Europa, für den Alpenraum, für das Baltikum, für Skandinavien und für den Balkan.
Wir wollen zudem die Zugänglichkeit touristischer sowie kulturell relevanter Ziele erleichtern, indem wir die Reaktivierung von Verkehrsinfrastruktur vorantreiben. Direktflüge zwischen sächsischen Flughäfen und den Nachbarländern Polen und Tschechien würden zusätzlich zur Erhöhung der Touristenzahlen beitragen und damit auch die Erreichbarkeit kultureller Angebote erhöhen. -
DIE LINKE
Der gesellschaftliche Austausch durch Kultur hat aus unserer Sicht eine große Wirkungsmöglichkeit im Austausch mit anderen Ländern. Durch eine Verstärkung und den Ausbau von Reisestipendien und Gastspielen, sowohl von Sachsen in andere Länder als auch nach Sachsen, sehen wir die Kultur als Hebel für ein besseres Verständnis anderer Kulturen und Lebensformen.
Wir stehen für eine nachhaltige und auskömmliche Finanzierung der Institutionen und der freien Szene, damit diese in die Möglichkeit versetzt werden, diesen Austausch weiter voranzutreiben und die kulturelle Landschaft Sachsens in den Nachbarländern und international besser sichtbar zu machen. Wir unterstützen die Entwicklung von Kulturprojekten zur Verständigung zwischen den Völkern, durch gemeinsame Kunst- und Kulturprojekte, Festivals und den interkulturellen Dialog, mit dem Schwerpunkt in den Grenzregionen. Insbesondere durch kulturelle Bildungs- und Austauschprogramme an Schulen, Hochschulen und Universitäten. -
BSW
Die wichtigsten transnationalen Kulturbeziehungen für Sachsen sind die, die sich seit vielen Jahren im östlichen und südlichen Grenzgebiet nach Polen und Tschechien entwickelt haben. Besonders in der Lausitz gibt es lebendige Beziehungen in beide Nachbarländer und nahe Nachbarstädte, bei deren Weiterentwicklung die Institutionen, aber auch die Kommunen unterstützt werden sollten. Der verdienstvolle »Sächsisch-Tschechische Theaterherbst«, der den Kontakt der Theater und Orchester im südsächsischen und nordböhmischen Raum (unter EU-Förderung) lebendig gestaltet hat, ist leider vor mehr als zehn Jahren eingestellt worden. Hier wäre zu prüfen, wie sich eine solche grenzübergreifende Zusammenarbeit, die ja v.a. in einem Gastspielaustausch besteht, wiederbeleben ließe.
Darüber hinaus verwirklichen sich transnationale Kulturbeziehungen an vielen Stellen in Städtepartnerschaften. Die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 hat ein Pendant in Nova Gorica, mit dem sie sich den Kulturhauptstadttitel teilt. Die Beziehungen zwischen beiden Partnerinnen sind aber von der Landespolitik aus nur interessiert zu betrachten und bedürfen keiner steuernden Eingriffe. -
FDP
Wir Freie Demokraten werden die Beziehungen auf europäischer und internationaler Ebene weiter stark auszubauen. Hierbei werden wir Projekte, die den kulturellen Austausch mit internationalen Partnern stärken, unterstützen und Städte- und Regionenpartnerschaften sowie Netzwerke zwischen kulturellen Institutionen aufbauen und pflegen. Zum Verständnis im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit wollen wir zudem kulturelle Sprachprogramme fördern.
Frage 2: Themenbereich „Resilienz und agile Kultur“
-
AfD
Die gestellte Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, weil nicht konkretisiert wird, welche Transformationen gemeint sind. Kultur gedeiht nach unserer Ansicht dann am besten, wenn sie die Möglichkeit hat, sich frei von staatlicher Einflussnahme zu entwickeln, die über eine grundsätzliche Bereitstellung von Fördermitteln und die Schaffung adäquater Rahmenbedingungen hinausgeht. Zwangsmaßnahmen, wie sie im Rahmen der Corona-Krise eingeführt wurden, sind Fehl am Platz. Dem angesprochenen Fachkräftebedarf ließe sich etwa dadurch begegnen, dass vermehrt Teilzeit- in Vollzeitstellen umgewandelt und hierfür entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden.
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Uns BÜNDNISGRÜNEN ist bewusst, dass die Gestaltung der Transformationen in verschiedenen Feldern kultureller Praxis sowohl auf eine stabilisierende und entwicklungsförderliche Kulturfinanzierung angewiesen ist, als auch durch eine aktiv unterstützende und moderierende Kulturpolitik des Freistaates gestärkt werden kann. Deshalb wollen wir den kulturpolitischen Austausch zwischen Kulturschaffenden, Verbänden, Politik und Verwaltung zur langfristigen Sicherung einer zukunftsfähigen und vielfältigen Kulturlandschaft ausbauen, insbesondere zu den Themen faire Vergütung, Publikumsstrategien, kooperative Strukturen, Diversität, Klimaschutz, Digitalität und Fachkräftemangel.
Unser Ziel ist es, ergebnisorientiert und auf Augenhöhe mit der sächsischen Kulturszene zusammenzuarbeiten und Anpassungsschritte im Rahmen landesweiter kulturpolitischer Strategien zu erarbeiten. (Zur Weiterentwicklung von Förderprogrammen, vgl. Frage 6)
Um die Rahmenbedingungen für den gemeinsamen Prozess zu verbessern, wollen wir eine Arbeitsstelle für die spartenübergreifende Zusammenarbeit mit den sächsischen Landeskulturverbänden fördern.
Als wichtigen Faktor für die Bewältigung des Fachkräftemangels ist das Vergütungsniveau im Kulturbereich zu erhöhen. Um die prekäre Einkommenssituation insbesondere von freien Kulturschaffenden zu verbessern, wollen wir verbindliche Honoraruntergrenzen für kulturelle Leistungen einführen, die durch Kulturförderung des Freistaates finanziert werden. Dies soll bereits ab 2025 in den Richtlinien der Landeskulturförderung umgesetzt werden. Das hat Signalwirkung auch für die kommunale Ebene, mit der wir eine Verständigung über ihre eigenverantwortliche Umsetzung anstreben. Dafür müssen praktikable Regelungen der Verbindlichkeit und Kontrolle in den Förderverfahren gefunden werden und die Budgets seitens des Freistaates und der Kommunen erhöht werden. Um den Einstieg in Richtung einer fairen Vergütung zu schaffen, ist mindestens eine stufenweise Einführung von Untergrenzen und ein schrittweises Aufwachsen der Mittel notwendig. -
BSW
Die allgegenwärtigen Krisen sind ja für die Kultur zunächst thematisch relevant; hier findet die Auseinandersetzung in allen Facetten bereits statt und die Kulturpolitik hat im Lichte der Kunstfreiheit werden zu raten, noch zu reglementieren.
Wirtschaftlich sind so gut wie alle Institutionen, aber auch die Freischaffenden und die freien Gruppen von signifikanten Kostenerhöhungen, v.a. im Sachkosten- und Energiebereich betroffen, die Theater und Orchester darüber hinaus von enormen Personalkostensteigerungen. Hier muss der Freistaat über eine Reform des Kulturraumgesetzes eingreifen und die Kostensteigerungen kompensieren – v. a. dort, wo die kommunalen Träger das nicht können.
Der Fachkräftemangel stellt sich unterschiedlich dar: bei den Theatern und Orchestern gibt es im künstlerischen Bereich keinen Fachkräftemangel. Wohl aber gibt es ihn in den technischen Gewerken, bei Veranstaltungstechnikern, Meistern, aber auch im Aushilfenbereich. Hier ist mit Geld wenig zu machen: die meisten Techniker an kommunalen Theatern verdienen bereits mehr als Künstlerinnen und Künstler. Abhilfe ist hier langfristig in einer verstärkten Ausbildung zu suchen (wie das der Arbeitgeberverband, der Deutsche Bühnenverein, schon seit einiger Zeit in Angriff genommen hat), aber dies sind kaum Lösungen für den Moment. Auch im künstlerisch-handwerklichen Bereich, hier v.a. bei den Maskenbildnerinnen, ist die Lage angespannt. -
CDU
Die Transformation der sächsischen Kultureinrichtungen ist ein Prozess, der in erster Linie in den Einrichtungen selbst vollzogen werden muss. Die Erfahrung der Mitarbeiter und der Leitungen der Einrichtungen sind dabei in erster Linie die Basis für eine erfolgreiche Transformation. Wir unterstützen diesen Prozess im Rahmen des Sächsischen Kulturraumgesetzes und begleiten die Transformation auch im Rahmen des in dieser Legislaturperiode begonnenen Kulturdialogs. Die sächsische Kulturförderung wie auch die Wirkung des Sächsischen Kulturraumgesetzes werden wir im kommenden Jahr einer Evaluation unterziehen, welche auch die aktuellen Herausforderungen und notwendige Transformationsprozess aufgreifen wird.
-
FDP
Wir Freie Demokraten wollen die Weiterentwicklung der Kulturszene als verlässlicher Partner unterstützen sowie effizienter fördern. Finanziell werden wir die Digitalisierung in den Kultureinrichtungen, Ausbildungsprogramme sowie Modernisierungsmaßnahmen unterstützend begleiten. Außerdem werden wir gemeinsam mit den Kulturschaffenden Strategien zur Krisenbewältigung und Resilienzsteigerung in Kultureinrichtungen entwickeln, um auf zukünftige Herausforderungen besser vorbereitet zu sein.
-
DIE LINKE
Den Fachkräftemangel im Kulturbereich wollen wir durch eine faire Vergütung im freien Bereich und ein angemessenes Tariflohnniveau entgegenwirken. Bestehende Haustarifverträge in Theatern und Orchestern müssen endlich in den Flächentarif überführt werden. Kommunen müssen finanziell in die Lage versetzt werden, Entgeltgruppen neu zu definieren und Kulturarbeit besser zu entlohnen.
Der Kunst- und Musikunterricht in den Schulen muss langfristig gesichert werden. Die dazu notwendigen Lehrkräfte brauchen Anreize und Möglichkeiten, als Multiplikatoren der Kultur aktiv werden zu können. Kulturelle Bildungsangebote müssen auch in der Fläche leichter zugänglich sein, die Institutionen finanziell und personell gestärkt werden. Die Kunst- und Musikschulen stärken wir durch eine bessere Finanzierung, um langfristig Nachwuchs adäquat auf das Studium an einer Kunst- oder Musikhochschule vorzubereiten und einen Kulturberuf zu ergreifen.
Weiterhin wollen wir die Hochschulen dazu anhalten und finanziell in die Lage versetzen, dass sie den Kulturberuf für den Nachwuchs erstrebenswert machen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Absolventinnen und Absolventen durch gute Arbeitsbedingungen in Sachsen bleiben. Außerdem wollen wir die Sichtbarkeit der Kultur erhöhen, um das gesellschaftliche Ansehen kultureller Berufe positiv zu verändern. Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifizierungsprogramme für jetzige und zukünftige Kulturschaffende, insbesondere für kulturelle Bildungsarbeit, werden wir fördern. -
SPD
Die SPD Sachsen möchte für Kultureinrichtungen eine höhere Planungssicherheit in der Kulturförderung herstellen, die eine Mehrjährigkeit sowie eine regelmäßige Anpassung vorsieht.
Hierin sehen wir eine wichtige Voraussetzung, damit Kulturschaffende und Kultureinrichtungen über die notwendige Sicherheit verfügen, um unvorhergesehenen Veränderungen aktiv begegnen zu können.
Die Beantragung einer Konzeptförderung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen wollen wir ab 2026 jährlich ermöglichen, die Prozessbegleitung durch die Stiftung verstärken und so die Organisationsentwicklungen in sächsischen Kultureinrichtungen verbessern.
Dem Fachkräftemangel im Kulturbereich, der sich während der Corona-Pandemie durch die Abwanderung von gut ausgebildeten Arbeitskräften in andere Branchen verstärkt hat, möchten wir durch gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne im Kulturbetrieb begegnen. Faire Bezahlung wollen wir dabei durch die Einführung von Honorarrichtlinien und Mindeststandards in der Kulturförderung absichern. Damit das vielfältige kulturelle Angebot nach Einführung von Honorarrichtlinien erhalten bleibt, setzen wir uns für eine verbesserte Kulturfinanzierung ein. Unser Ziel ist es dabei auch, dass mehr Kulturschaffende aus anderen Regionen Deutschlands oder Europas Sachsen als attraktiven Arbeitsort entdecken und so neue Fachkräfte gewonnen werden können.
Frage 3: Themenbereich „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“
2015 hat die UN 17 Nachhaltigkeitsziele für soziale, ökonomische und ökologische Entwicklungen definiert, für menschenwürdiges Leben weltweit und dauerhafte Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Mit welchen Maßnahmen werden Sie dieses Ziel in der sächsischen Kultur verankern und voranbringen?
-
SPD
Auch in Sachsen leisten wir unseren Beitrag, damit die Agenda 2030 ihre Wirkung entfalten kann. Gerade Themen wie Geschlechtergleichheit (SDG 5), menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) und hochwertige Bildung (SDG 4) werden uns in den kommenden Jahren im Kulturbereich weiter beschäftigen. So werden wir gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung für Kulturschaffende durch die Einführung von Honorarrichtlinien und Mindeststandards absichern. Schieflagen wie der Gender Pay Gap und der Equal Show Gap in den Kulturberufen nehmen wir in den kommenden Jahren besonders in den Blick. Angebote der kulturellen Bildung werden wir landesweit weiter ausbauen und durch die Ansätze von „Kultur für alle“ und „Kultur mit allen“ einen gleichberechtigten Bildungszugang ermöglichen. Darüber hinaus wird Projekten und Einrichtungen, die sich in ihren Arbeiten mit künstlerischen Mitteln generell für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele einsetzen, die sächsische Kulturförderung weiterhin offenstehen.
-
DIE LINKE
Wir wollen Pilotprojekte wie „E Tool Kultur“, welches sehr erfolgreich in Leipzig und Dresden getestet wurde, landesweit nutzbar machen. Weiterhin sehen wir in den Leitfäden für eine nachhaltige Kultur, wie aktuell in Leipzig, einen ersten Schritt in dieser Thematik. Institutionen im Kulturbereich können sich diesem Thema einfacher widmen, wenn die aktuellen finanziellen Herausforderungen wie Inflation, Investitionsstau und Personalkostensteigerungen durch ein Kulturentwicklungskonzept 2035 gelöst werden. Wir sehen den Freistaat in der Pflicht, für eine Sanierung der Einrichtungen dauerhaft Mittel bereitzustellen. Um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) im sächsischen Kulturbereich zu verankern und voranzubringen, wollen wir folgende Maßnahmen ergreifen:
1. Bildung für nachhaltige Entwicklung (SDG 4)
-
- Bildungsprogramme und Workshops: Entwicklung und Förderung von Bil-dungsprogrammen und Workshops in Kultureinrichtungen, die das Bewusst-sein für Nachhaltigkeit und die SDGs stärken.
- Kooperationen mit Schulen und Universitäten: Partnerschaften mit Bil-dungseinrichtungen, um Themen der nachhaltigen Entwicklung in den Lehr-plan und in kulturelle Aktivitäten zu integrieren.
2. Förderung von Geschlechtergleichstellung und Inklusion (SDG 5 und SDG 10)- Gleichstellung in Kultureinrichtungen: Maßnahmen zur Förderung der Ge-schlechtergleichstellung und Inklusion in allen kulturellen Bereichen und auf allen Ebenen.
- Diversity-Programme: Unterstützung von Programmen und Projekten, die die kulturelle und soziale Vielfalt fördern und Diskriminierung entgegenwir-ken.
3. Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)- Kultur als Teil der Stadtentwicklung: Integration kultureller Aspekte in die Stadtplanung und -entwicklung, um nachhaltige, lebenswerte und kulturell reiche Städte und Gemeinden zu schaffen.
- Förderung lokaler Kulturprojekte: Unterstützung von Kulturprojekten, die lokale Identitäten stärken und den Gemeinsinn fördern.
4. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster (SDG 12)- Umweltfreundliche Veranstaltungen: Implementierung nachhaltiger Prakti-ken bei der Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen, z.B. durch Müllvermeidung, Recycling und den Einsatz erneuerbarer Energien.
- Nachhaltige Beschaffung: Förderung nachhaltiger Beschaffungspolitiken in Kultureinrichtungen, z.B. durch den Kauf umweltfreundlicher Materialien und Produkte.
5. Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13)- Kulturprojekte zum Klimaschutz: Unterstützung von Kunst- und Kulturpro-jekten, die sich mit dem Thema Klimaschutz und Umweltschutz auseinan-dersetzen sowie das Bewusstsein dafür schärfen.
- Reduzierung der CO2-Bilanz: Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Bilanz von Kultureinrichtungen, z.B. durch Energieeffizienz und nachhaltige Mobili-tät.
6. Leben unter Wasser und Leben an Land (SDG 14 und SDG 15)- Naturschutz in der Kunst: Förderung von Kunstprojekten, die sich mit dem Schutz der Meere, Flüsse und der Biodiversität an Land beschäftigen.
- Umweltbildung: Integration von Umweltbildung in kulturelle Angebote, um das Bewusstsein für den Schutz von Ökosystemen und Biodiversität zu stärken.
7. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (SDG 17)- Kooperationen und Netzwerke: Aufbau und Stärkung von Partnerschaften und Netzwerken zwischen Kultureinrichtungen, NGOs, Bildungseinrichtun-gen und internationalen Organisationen zur gemeinsamen Verfolgung der SDGs.
- Wissenstransfer und Austausch: Förderung des internationalen Austauschs von Wissen und Best Practices zur Umsetzung der SDGs im Kulturbereich.
8. Arbeit und wirtschaftliches Wachstum (SDG 8)- Gute Arbeitsbedingungen: Sicherstellung fairer Arbeitsbedingungen und Löhne für alle Beschäftigten im Kulturbereich.
- Förderung kreativer Industrien: Unterstützung von Projekten und Initiativen, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Wachstum im kreativen Sektor beitragen. Durch diese Maßnahmen kann die sächsische Kultur einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele leisten und dabei soziale, ökonomische und ökologische Aspekte integrieren.
-
-
FDP
Wir Freie Demokraten wollen die verstärkte Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die kulturelle Bildung und Programme, um Bewusstsein und Wissen zu fördern. Förderung von ressourcenschonenden Praktiken in Kultureinrichtungen, wie Energieeffizienz und Abfallvermeidung werden wir ebenso etablieren.
-
CDU
Die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele findet im Freistaat Sachsen ihre Entsprechung in der Umsetzung der sächsischen Nachhaltigkeitsstrategie, welche bereits im Jahre 2018 verabschiedet wurde und in den neun Handlungsfeldern auch den Bereich der Kultur beinhaltet. Diese Strategie bildet die Grundlage dafür, dass Maßnahmen des Freistaates Sachsen, auch im Bereich der Kultur, den Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung entsprechen und die Nachhaltigkeit der einzelnen Maßnahmen unter sozialen, ökologischen und natürlich auch ökonomischen Anforderungen sinnvoll und langfristig nachhaltig ausgerichtet werden. Insofern ist dieser Prozess auf alle Maßnahmen der Freistaates Sachsen ausgerichtet, ohne dass einzelne Maßnahmen an dieser Stelle benannt werden.
-
BSW
keine Antwort
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Unsere Kulturpolitik orientiert sich an umfassenden Nachhaltigkeitszielen. Deshalb setzen wir uns für den Paradigmenwechsel hin zu einer kostendeckenden Kulturfinanzierung und mehr Planungssicherheit ein, um den Erhalt und die Entwicklungsfähigkeit der vielfältigen regionalen kulturellen Infrastruktur und kulturellen Szene zu ermöglichen. Die Verbesserung der Einkommenssituation von Kulturschaffenden ist für uns ein besonderer Schwerpunkt (vgl. Frage 31.2) ebenso wie die Geschlechtergerechtigkeit im Kulturbereich, die wir durch die paritätische Besetzung von Jurys und Beiräten, ein Landesfrauenkulturbüro für Vernetzung, Beratung und Interessenvertretung sowie mehr Vereinbarkeit von künstlerischer Arbeit und Familie bei Stipendienprogrammen voranbringen wollen. Um die ökologische Transformation des Kulturbereichs zu unterstützen, wollen wir neue Förderprogramme auflegen und Kulturförderung mit den Kriterien Energieeffizienz, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit im Ressourceneinsatz verbinden. Kulturbauten und -sanierungen werden wir unter klimaneutralen Gesichtspunkten konzipieren und die CO2-Bilanzierung für Kulturbetriebe ausbauen. Wir setzen uns für eine sächsische Anlaufstelle Green Culture ein, die sächsische Kulturakteur*innen informiert und berät.
-
AfD
Der Klimawandel lässt sich nicht vermeiden, weswegen der Schwerpunkt künftig auf der Klimafolgenanpassung liegen muss. Dies gilt auch – aber nicht nur – für Kultureinrichtungen.
Frage 4: Themenbereich „Inklusion und Diversität“
In Sachsen ist Vielfalt in der Gesellschaft gelebte Realität. In der sächsischen Kultur werden Barrierefreiheit, Inklusion und Diversität jedoch nicht adäquat umgesetzt. Wie greifen Sie kulturpolitisch ein, um unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen vor und auf die Bühne zu bringen?
-
DIE LINKE
Ja, in Sachsen gibt es Vielfalt – aber als Linke sehen wir das noch nicht als „gelebte Realität“, dafür sind noch viele Schritte notwendig.
Doch nun zu Ihrer Frage. Die Kulturstiftung des Freistaats muss finanziell in die Lage versetzt werden, spezielle und zielgerechte Förderprogramme und Förderrichtlinien zu Thema Inklusion und Diversität zu initiieren. Zusätzliche wollen wir einen Kulturfonds einrichten, mit dem die Voraussetzung geschaffen wird, sich mit den Themen Migration, Inklusion und dem interkulturellen Dialog auseinanderzusetzen. Inklusive Veranstaltungsplanung, die sich bewusst mit dem Thema Barrierefreiheit auseinandersetzt, gehört für uns in die Konzeptionen von Förderungen, Institutionen und in den Bereich der Ausbildung der Kulturschaffenden. Durch gezielte Ansprache, z.B. durch Stipendien- und Residenzprogramme für Künstlerinnen und Künstler aus marginalisierten und weniger repräsentierten Gruppen steigern wir deren Wahrnehmbarkeit.
Die Institutionen, von den Hochschulen bis zu den Theatern und Einrichtungen der kulturellen Bildung, müssen sensibilisiert und durch partizipative Konzepte umgesetzt werden.
Weiterhin stehen wir für eine engere Zusammenarbeit der Institutionen und der freien Szene: diese können aktuelle gesellschaftliche Themen aufnehmen und auf den Bühnen und in den Clubs Sachsens in die Gesellschaft tragen. Kulturbeiräte sollen in ihrer Besetzung auf eine vielfältige Repräsentation der Gesellschaft Rücksicht nehmen. Durch diese Maßnahmen kann die sächsische Kulturpolitik einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Barrierefreiheit, Inklusion und Diversität leisten und sicherstellen, dass die kulturelle Landschaft die gelebte Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt. -
AfD
Wir halten es grundsätzlich nicht für geboten, politisch in die Kultur „einzugreifen“, um diesen oder jenen (vermeintlichen) Missstand zu beheben. Regelungen oder gar Quoten zur Einführung repräsentativer Diversität auf sächsischen Bühnen lehnen wir ab. Soweit in Kultureinrichtungen des Freistaates Sachsen ein Mangel an barrierefreien Angeboten bzw. barrierefreier Infrastruktur besteht, werden wir uns selbstverständlich für eine Verbesserung der Situation einsetzen.
-
SPD
Inklusion im kulturellen Bereich ist uns ein Herzensanliegen. Dabei geht es uns nicht nur um die Barrierefreiheit von kulturellen Angeboten, sondern auch darum, Kultur- und Medienschaffende mit Behinderungen zum selbstverständlichen Bestandteil unserer sächsischen Kultur und Medienlandschaft zu machen. Entsprechende inklusionsfördernde Maßnahmen fördern wir weiter dauerhaft, so etwa die Servicestelle Inklusion im Kulturbereich beim Landesverband Soziokultur, und halten daran fest, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Sachsen auch im Kulturbereich weiterhin umgesetzt wird. Vielfältige Perspektiven im Kulturbereich möchten wir bei der Förderung stärker berücksichtigt wissen. Wir werden daher darauf hinarbeiten, dass Auswahlgremien im Bereich der Kulturförderung diverser besetzt sind und Diversität als Querschnittsaufgabe in der Zielsetzung der Kulturförderung definiert wird.
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Wir BÜNDNISGRÜNE wollen Inklusion als Ziel in der sächsischen Kulturförderung fest verankern, barrierefreie kulturelle Angebote, die Beteiligung an und Gestaltung von Kulturangeboten durch Menschen mit Behinderung sowie das Empowerment von Künstler*innen mit Behinderungen unterstützen. Damit die Barrierefreiheit sächsischer Kulturangebote konsequent umgesetzt werden kann, sollen verstärkt inklusive Koordinations- und Beratungsangebote sowie Investitionen unterstützt werden. Die „Servicestelle Inklusion im Kulturbereich“ sensibilisiert, berät, qualifiziert und vernetzt Kultureinrichtungen aller Kultursparten in Sachsen zum Thema Barrierefreiheit. Die Stelle soll mehr finanzielle Unterstützung erhalten. Die Kulturstaatsbetriebe sollen Inklusion im Rahmen eigener Handlungskonzepte fortentwickeln. Dabei sind Menschen mit Behinderungen als Expert*innen in eigener Sache aktiv zu beteiligen. Wir wollen für die Förderrichtlinie „Inklusion“ wieder mehr Mittel in den Haushalt einstellen, damit z.B. Filmfestivals, Webseiten oder Führungen barrierefrei umgesetzt werden können. Wir stärken die Diversität in der Kultur und werden Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte gleichberechtigte Teilhabe an Kultur und kulturellem Schaffen ermöglichen. Dafür erarbeiten wir eine Landeskonzeption zur transkulturellen Öffnung des Kulturbereichs und fördern Festivals und andere Kulturangebote von und mit zugewanderten Menschen sowie die Vernetzung transkultureller Initiativen.
-
FDP
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass jedem Einzelnen, unabhängig von seinen persönlichen Voraussetzungen, der Zugang zu allen Möglichkeiten offensteht, um sich selbst und seine Potenziale zu entwickeln und zu entfalten. Staatliche Eingriffe und Vorgaben lehne wir ab, stattdessen wollen wir mit Anreizen gezielt Kultur für jeden möglich machen. Wir wollen hierbei Projekte unterstützen, die gezielt unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen einbinden und Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen kulturellen Hintergründen unterstützen. Inklusion ist für uns dabei eine Querschnittsmaterie, welche wir mit der konsequenten Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention begegnen wollen.
-
CDU
Vielfalt, auch in der Kultur, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich auch die sächsischen Kultureinrichtungen stellen müssen und dies auch bereits in besonderer Weise vollziehen. Wir unterstützen diese Bestrebungen im Rahmen unserer Kulturförderung sowie der Umsetzung und Fortentwicklung des Sächsischen Kulturraumgesetzes.
-
BSW
AUF der Bühne wird das Themenfeld Inklusion und Diversität an vielen Stellen in der sächsischen Kultur ausführlich wahrgenommen; Kulturpolitik hat hier jedoch nicht einzugreifen.
VOR der Bühne, im Praktischen, gibt es mittlerweile an vielen Häusern Programme zur Barrierefreiheit; sie sind alle kostenintensiv. Hier wäre eine starke finanzielle Unterstützung seitens des Freistaats wichtig; die Träger können das allein nicht leisten.
Frage 5: Themenbereich „Digitalität“
Künstliche Intelligenz wird als Chance und Herausforderung von den Kulturbetrieben und Kulturschaffenden wahrgenommen. Digitale Infrastruktur ist eine Voraussetzung für Zukunftsfähig-keit. Wie werden Sie die digitale Entwicklung in den sächsischen Kultureinrichtungen und Verwaltungen voranbringen?
-
BSW
Künstliche Intelligenz wird in ihrer jetzt sichtbaren Form von Kulturschaffenden vorrangig als Bedrohung und keineswegs als Chance wahrgenommen. Kunst wird von Menschen gemacht, ausschließlich.
Digitale Infrastruktur im Verwaltungsbereich ist ein anderes Thema; da werden die Kulturbetriebe nur im Gleichklang mit den staatlichen und kommunalen Akteuren arbeiten können.
Die eigenen digitalen Planungsinstrumente, etwa der Theater und Orchester (vorrangig die Software Theasoft), benötigen in hohem Maße zusätzliches Personal und wirken an vielen Stellen eher bremsend. -
Bündnis 90/ Die Grünen
Kulturakteur*innen und Einrichtungen werden wir dabei unterstützen, ihre digitalen Kompetenzen und Angebote über Vernetzung, Wissenstransfer und Weiterbildung zu erweitern. Wir wollen die Förderung digitaler Kunst und der interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich der Kultur des digitalen Wandels über die Kulturstiftung des Freistaates weiter stärken. Die Angebote des von der Bundesregierung geförderten „Datenraums Kultur“ wollen wir landesweit nutzbar machen. Die Implementierung von KI auch im Kulturbereich wird die Umwälzungen durch die Digitalisierung weiter beschleunigen. Wir wollen gemeinsam mit den Kulturakteur*innen die Entwicklungen eng begleiten, Chancen für Innovation und Arbeitsfähigkeit ebenso wie ethische oder erwerbsökonomisch gebotene Begrenzungen diskutieren und weitere Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der kulturpolitischen Strategiebildung des Freistaates erarbeiten.
-
SPD
Den während der Corona-Pandemie ausgelösten Digitalisierungsprozess in Kultureinrichtungen möchten wir aufrechterhalten und werden diesen künftig mit Investitionen unterstützen. Mit den Kulturträgern möchten wir zu den Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels im Kulturbereich im Austausch bleiben und hieraus notwendige Maßnahmen ableiten. Im Rahmen der sächsischen Digitalstrategie werden in den kommenden Jahren die Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung und die digitale Transformation in den Kultur- und Staatsbetrieben des Freistaates Sachsen weiter vorangebracht. Wir werden prüfen, ob eine Übertragbarkeit von erfolgreichen Programmen wie dem bei der SLUB angesiedelten Landesdigitalisierungsprogramm in andere Kulturbereiche möglich ist.
-
CDU
Die Digitalisierung ist eine Aufgabe, welcher sich auch die sächsischen Kultureinrichtungen stellen müssen. Hierbei ist jedoch Individualität und die Beachtung der jeweiligen Angebote sowie deren Spezifik im Hinblick auf die Nutzung digitaler Infrastruktur besonders zu würdigen. Starre staatliche Vorgaben sind hier aus unserer Sicht wenig gewinnbringend. Welche Angebote digital weiterentwickelt werden sollen und wie die Zielgruppen in den Prozess eingebunden sind und von diesem profitieren, sollten daher die Einrichtungen vor Ort selbst entscheiden. Wir unterstützen sie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mitteln zur Förderung von Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen.
-
AfD
Digitalisierung setzt eine entsprechende Infrastruktur voraus. Deshalb haben wir im Landtag bereits vor Jahren gefordert, das Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes unverzüglich mit Landesmitteln kozufinanzieren. Zugleich treten wir für die Erhaltung des Rechts von Bürgern auf ein analoges Leben außerhalb von digitalisierten Verwaltungs- und Alltagsabläufen ein.
-
DIE LINKE
Digitalisierung und KI sind Herausforderung und Chance zugleich, dass sehen wir auch so. Insbesondere im Kontext der Nachhaltigkeit und Chancengleichheit können digitale Prozesse und Konzepte eine Chance sein. Die KI eröffnet der Kultur ebenfalls neue kreative Wirkungsmöglichkeiten. Doch darf es nicht dazu führen, dass „Erleben“ von menschengemachter Kultur herunterzufahren. Insbesondere in der kulturellen Bildung und in neuen Kulturformaten transportiert sich aus unserer Sicht die Wirkung am besten durch die Menschen, die es erschaffen und umsetzen. Für die Kulturschaffenden stehen wir für eine bessere Vergütung durch Verwertungsgesellschaften und bei digitalen Plattformen. Open-Source Software soll gefördert, spartenübergreifend entwickelt und für alle frei zugänglich sein. Wir unterstützen experimentelle, digitale Kulturprojekte, die neue Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality und künstliche Intelligenz nutzen. Energieeffiziente IT-Infrastruktur und digitale Nachhaltigkeit sehen wir als einen Weg, die CO2-Bilanz zu minimieren und für eine umweltbewusste Nutzung digitaler Technologien zu sensibilisieren. Alle diese Angebote sollen barrierefrei sein, um Menschen mit Beeinträchtigungen uneingeschränkten Zugang zu gewährleiten. KI und Digitalität darf nicht zum „Sparen an Kultur“ führen, sondern sind für eine bessere Erreichbarkeit kostenfreier kulturellerer Angebote und neuen Kreativprozessen zu nutzen. Durch diese Maßnahmen will Die Linke die digitale Entwicklung in den sächsischen Kultureinrichtungen und Verwaltungen vorantreiben, während die Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit, Nach und demokratischer Teilhabe gestärkt werden.
-
FDP
Wir Freie Demokraten drängen auf eine Verwaltungsdigitalisierung, die sowohl für den Bürger als auch für die Kulturschaffenden tatsächlich Effizienzgewinne bietet. Daher müssen Digitalisierungsprojekte verstärkt zu einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung führen. Das gesamte Verwaltungsverfahren muss automatisiert abgewickelt werden können. Wir werden das Onlinezugangsgesetz konsequent umsetzen und bis 2028 alle Verwaltungsdienstleistungen 24/7 für die Bürger online verfügbar machen.
Frage 6: Themenbereich „Förderprogramme und Kulturverwaltung“
Publikumsentwicklung, Digitalisierung, transnationale Kultur – um Herausforderungen begegnen zu können, bedarf es Investitionen in die personellen und sächlichen Ressourcen der Kultur auf allen Ebenen. Wie werden Sie bestehende Förderinstrumente verbessern oder neue Ansätze etablieren?
-
FDP
Wir Freie Demokraten wollen die Kulturförderung auf Pauschalförderung der Kulturräume umstellen. Dort sitzen die Experten, die am besten wissen, wie die Förderung in ihrem Bereich sinnvoll eingesetzt werden kann. Zudem wollen wir die Förderbürokratie der mehrstufigen Prüfverfahren im Nachgang einer Förderung vereinfachen. Darüber hinaus muss sich das Kulturraumgesetz viel stärker für neue kulturelle Angebote in Sachsen öffnen. Die Zuwendungen des Freistaates werden wir dynamisieren und insbesondere an die Lohnentwicklung anpassen.
-
BSW
Die zentrale Herausforderung der sächsischen Kulturpolitik der nächsten Jahre ist die Reform des Kulturraumgesetzes, das in seiner bisherigen Form mit jahrelang geltenden festen Zuschußsummen agiert und die ständig steigenden Personal- und Sachkosten ignoriert. Das Kulturraumgesetzt muss dynamisiert werden, so dass alle über die Kulturräume unterhaltenden Institutionen und Projekte planungssicher stabilisiert werden.
Die Kulturstiftung des Freistaats muss bei den von ihr geförderten Projekten die gestiegenen Sachkosten und vor allem die für Freischaffende gestiegenen Lebenshaltungskosten reflektieren und in die Höhe der Fördersummen einfließen lassen. -
AfD
Kulturförderung ist eine vornehme staatliche Aufgabe, die nach unserer Auffassung auch weiterhin einen festen Platz im Fördersystem des Freistaates Sachsen einnehmen soll. Das aktuell bestehende System der Förderrichtlinien und -Möglichkeiten im Freistaat Sachsen gehört jedoch – nicht nur auf dem Gebiet der Kultur – auf den Prüfstand. Wir streben eine umfassende Evaluierung an, deren Ziel darin besteht, die Transparenz erhöhen, den Verwaltungsaufwand zu verringern, Notwendiges und Überflüssiges voneinander zu unterscheiden, politische Einseitigkeit zu vermeiden, klare Zielsetzungen festzuschreiben sowie Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen.
-
CDU
Wie bereits unter Frage 2 formuliert, besteht aus unserer Sicht der Bedarf, die sächsische Kulturförderung, auch die institutionelle, sowie das Sächsische Kulturraumgesetz in der kommenden Legislaturperiode umfassend zu evaluieren und im Dialog mit den Beteiligten unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen fortzuentwickeln. Dieser Prozess, unter wissenschaftlicher Begleitung, sollte auf langfristig tragfähige Förderinstrumente ausgerichtet sein. Insofern möchten wir den angestrebten Ergebnissen und Schlussfolgerungen derzeit durch ausgewählte, nicht kontextualisierte Zielstellungen vorgreifen.
-
SPD
Auf Basis der anstehenden Evaluation des Kulturraumgesetzes und im Einklang mit den neuen Leitlinien und Grundsätzen einer landesweiten Kulturentwicklungsplanung wollen wir das Kulturraumgesetz novellieren. Ziel ist es, Planungssicherheit in der Kulturförderung herzustellen, die eine Mehrjährigkeit sowie regelmäßige Anpassungen vorsieht und Mindesthonorare im Bereich der öffentlichen Kulturförderung berücksichtigt. Für die Ausarbeitung einer landesweiten und langfristig angelegten Kulturentwicklungsplanung möchten wir ein Expertengremium oder eine parlamentarische Enquete-Kommission einsetzen. In diesen Prozess werden wir Akteure aus der Freien Kultur, den Landeskulturverbänden und des Kultursenats genauso wie Vertreter:innen der Kulturräume sowie der Städte und Gemeinden einbinden und uns auf Ziele und Prioritäten für Sachsen verständigen – gemeinsam entscheiden wir also, wie wir die vielfältige Kulturlandschaft Sachsens nicht nur erhalten, sondern auch zeitgemäß weiterentwickeln können. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Themen wie Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Publikumsentwicklung und Digitalisierung.
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Wir setzen uns für den Erhalt einer lebendigen Kultur im ländlichen Raum und in den Großstädten ein und erkennen den Wert der Vielfalt kultureller Formen und Angebote vom Kulturraumtheater bis zur Soziokultur. Die Instrumente der Kulturförderung in Sachsen müssen stärker auf die verschiedenen Herausforderungen und eine allgemeine Resilienz und Entwicklungsfähigkeit ausgerichtet werden, damit Kultur in Zukunft relevant bleibt und eine breite Teilhabe ermöglicht. Dazu gehört eine stärkere Prozessorientierung bestehender Förderinstrumente, insbesondere durch mehrjährige Förderzeiträume.
Wir brauchen zudem eine gezielte Unterstützung von konzeptioneller Arbeit, Organisationsentwicklung, Publikumsentwicklung und partizipativer Öffnung von Kulturorten, Angeboten und Programmen, Modellen für neue Führungs- und Organisationsformen, regionalen Entwicklungskonzepten sowie Kooperationen verschiedener Einrichtungen und Initiativen aus Kultur und anderen Bereichen. Die Kulturfinanzierung muss Handlungsspielräume für die Umsetzung der Entwicklungsaufgaben ermöglichen.
Von der aktuellen strukturellen Unterfinanzierung der nicht-staatlichen Kultur aufgrund von Kostensteigerungen müssen wir wegkommen, sonst verlieren wir kulturelle Vielfalt. Die Förderbudgets der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen wollen wir entsprechend erhöhen. In das sächsische Kulturraumgesetz nehmen wir eine Dynamisierung der Mittel im Sinne einer regelmäßigen Anpassung an die Kostensteigerungen auf.
Zudem wollen wir die Kommunalfinanzierung im Allgemeinen sowie die für Kultur zweckgebundenen Mittel im Finanzausgleichsgesetz (FAG) so anpassen, dass Kommunen und Kulturräume ihren finanziellen Anteil zur Strukturstabilisierung leisten können. -
DIE LINKE
Die Kulturlandschaft in Sachsen braucht aus unserer Sicht einen Kulturentwicklungsplan 2035, der im Zuge der Evaluation des Kulturraumgesetzes entworfen und in die gemeinsame Zielstellung und Umsetzung mit allen Akteurinnen und Akteuren aufgenommen werden muss. Kultur braucht Planungssicherheit, eine dynamisierte Finanzierung, eine gute personelle Ausstattung auf allen Ebenen und eine bürokratiearme Antragsstellung, um den genannten Herausforderungen begegnen zu können. Erhöhung der finanziellen Mittel, eine langfristige Förderung durch neue Fördermodelle und eine vereinfachte Antragsstellung sind aus unserer Sicht hierzu notwendig. Neue Förderansätze im Bereich der digitalen Transformation, gezielte Publikumsansprache zur Erreichung neuer Zielgruppen und transnationale Kulturarbeit sehen wir als Chance für die sächsische Kulturlandschaft.
Frage 7: Themenbereich „Demokratiebildung“
Demokratie existiert nicht einfach – sie wird gemacht. Kultur hat das Potential und die Kraft Teil-habe an demokratischen Prozessen zu vermitteln, indem sie Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht. Wie werden Sie die Kultur bei der Entfaltung dieses Potentials unterstützen?
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Wir werden die Rahmenbedingungen für aktive kulturelle Teilhabe möglichst vieler Bürger*innen und die partizipative Öffnung von Kulturangeboten, kultureller Programmatik und regionaler Kulturentwicklung als wichtiges Thema im Rahmen der landesweiten kulturpolitischen Strategiebildung bearbeiten und auf dieser Grundlage Förderinstrumente ausbauen bzw. neu aufsetzen. Damit Kultur ihr Potential als Raum für Dialog und Verständigung, für demokratische Selbsterfahrung und gemeinschaftliche Gestaltung in einer vielfältigen und polarisierten Gesellschaft entfalten kann, braucht es konzeptionelle Vertiefung, fachlichen Austausch und praxisnahe inhaltlich-methodische Beratung. Auch innerhalb der Kulturbetriebe wollen wir die demokratische Kultur und Mitbestimmung stärken, etwa durch Modellprojekte für neue Führungs- und Organisationsformen. Damit Kultur Demokratie machen kann, müssen wir sie selbst schützen und unterstützen. Denn die Kunstfreiheit gerät in Sachsen immer mehr in Bedrängnis, gerade weil Kultur als Teil einer demokratischen Zivilgesellschaft aktuelle Demokratiegefährdung oder Angriffe auf die Menschenwürde thematisiert oder Integrationsarbeit leistet. Deshalb müssen wir Kulturakteur*innen seitens des Freistaates besser vor Einschüchterungen von Rechtsextremist*innen und Demokratiefeind*innen schützen und Einflussnahmen auf Inhalte, Sprache und Programme klar zurückweisen.
-
FDP
Wir Freie Demokraten wollen die kulturellen Demokratiepotentiale nutzen, indem wir kulturelle Bildung fest in Schulen und Bildungseinrichtungen verankern. Projekte, die demokratische Teilhabe und kulturelle Vielfalt stärken und fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, wollen wir unterstützen und fördern.
-
CDU
Kunst und Kultur sind fester Bestandteil der gesellschaftlichen Entwicklung und der Sicherung unserer demokratisch geprägten Gesellschaft. Wir erkennen diese Leistung auch im Rahmen der Förderung von Kunst und Kultur an. In dem wir die Förderung von Kunst und Kultur in allen Bereichen, auf kommunaler wie auch auf staatlicher Ebene, langfristig sicherstellen und hierfür mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz eine verlässliche Basis schaffen, sichern wir auch diese Aufgabe im Interesse der Entwicklung unseres Freistaates umfassend ab.
-
AfD
Soweit mit dem Begriff Demokratiebildung etwa die Vermittlung der Funktionsweise der Demokratie und ihrer Institutionen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sowie einer respektvollen Debattenkultur gemeint sind, werden wir bestehende Programme gerne weiter unterstützen. Eine Vermengung bzw. Aufladung des Demokratiebegriffs mit ideologisch und parteilich bedingten Forderungen lehnen wir jedoch ab.
-
DIE LINKE
Sachsen hat die größte Theaterdichte in ganz Deutschland: Diese Räume gilt es für den gesellschaftlichen Diskurs mehr zu öffnen. Dazu braucht es Fachpersonal, welches vor Ort mit den Menschen in den Regionen Programme entwirft, um Menschen aller Generationen an die Kraft der Selbstwirksamkeit durch Kultur heranführen. Um für einen stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft einzustehen und ein weltoffenes Sachsen erlebbar werden zu lassen. Wir wollen als Linke, die Förderung der kulturellen Vielfalt vorantreiben. Auch durch die Stärkung der kulturellen Bildung die Förderung von soziokulturellen Zentren die Stärkung von Bürgerbeteiligung durch Kultur sowie durch die Förderung von Medienkompetenz erwarten wir uns eine Stärkung von demokratischen Prozessen und stärkt gleichzeitig das Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und demokratische Prinzipien.
-
SPD
Kunst und Kultur sind Spiegel und Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Sie sind Ausdruck und unverzichtbares Element der demokratischen Grundordnung. Wir fördern Kunst und Kultur, ohne ihre freie Entfaltung zu behindern. Wir würdigen Kunst und Kultur im Hinblick auf ihre Funktion, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern – gerade in Zeiten, die von Wandel besonders intensiv geprägt sind. Wichtig ist es uns, den Zugang zu Förderung so einfach wie möglich zu gestalten. Menschen, die sich aktiv einbringen und demokratische Prozess mit kulturellen Mitteln gestalten möchten, bestärken wir und bieten dazu weiterhin niedrigschwellige Programme wie den Kleinprojektefonds für den ländlichen Raum bei der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Darüber hinaus entwickeln wir die Programme „Soziale Orte“ und „Orte der Demokratie“ weiter und bauen sie aus, um die aktivierende Gemeinwesenarbeit zu unterstützen.
-
BSW
Demokratie ist für viele Akteure in der Kultur ein wichtiges Thema geworden, das sich sowohl in den Stoffen, wie auch in partizipativen Veranstaltungsformen niederschlägt. Die Akteure, Institutionen wie Freischaffende, sind frei, ob und wie sie sich des Themas annehmen. Staatliche Einflussnahme, also auch Unterstützung, kann deshalb nur da geschehen, wo sie von den Akteuren gesucht wird. Da, wo das geschieht, wäre eine finanzielle Hilfe dort sinnvoll, wo besonders durch thematisch orientierte neue Veranstaltungsformen Kosten entstehen, die über den Normalbetrieb hinausgehen.
Frage 8: Themenbereich „Kulturelle Bildung“
Kulturelle Bildung schafft gruppenübergreifende Gemeinschaft und unterstützt eine »Kultur für alle«. Sie fördert die individuelle Entfaltung und kulturelle Kompetenzen. Wie gewährleisten Sie, dass die vielfältigen Aufgaben der Kulturellen Bildung ausgewogen umgesetzt werden?
-
CDU
Wir behalten die kulturelle Bildung als einen Schwerpunkt der sächsischen Kulturpolitik bei. Sie ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine funktionierende Gesellschaft. Sie verdient unser besonderes Augenmerk, um möglichst frühzeitig Talente zu fördern, das Verständnis für Kultur und Kunst zu wecken und die Teilhabe an kulturellen Angeboten und Veranstaltungen zu eröffnen. Bereits im regulären Unterricht in den sächsischen Schulen ist kulturelle Bildung ein wichtiger Bestandteil und sollte umfassend in den entsprechenden Fächern und fächerübergreifend erfolgen. Im Bereich der Ganztagsangebote eröffnen wir weitere Möglichkeiten, sich künstlerisch zu betätigen und Erfahrungen und Kompetenzen zu erlernen. Darüber hinaus unterstützen wir die sächsischen Musikschulen sowie die Jugendkunstschulen durch eine gezielte Förderung in ihrer Entwicklung und der Förderung von Talenten.
-
AfD
Wir legen Wert darauf, dass Kinder von klein auf mit Kunst und Kultur vertraut gemacht werden und die Möglichkeit erhalten, ihre Talente zu entdecken. Wir stehen für eine um-fassende kulturelle Bildung unserer Schüler, für eine bessere Ausstattung von Musik- und Jugendkunstschulen sowie für eine breitere Förderung begabter Kinder – ganz unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.
-
SPD
Wir verfolgen die Strategie, allen Kindern und Jugendlichen eine aktive Teilhabe an Angeboten der kulturellen Bildung zu ermöglichen, ganz gleich, an welchem Ort in Sachsen sie leben. Um Kooperationen zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe weiter zu befördern, werden wir die Netzwerkstellen „Kulturelle Bildung“ in den Kulturräumen stärken. Jugendkunstschulen und soziokulturelle Zentren in Sachsen, die mit ihren Programmen alle Generationen erreichen und unentbehrliche Partner gerade im ländlichen Raum sind, möchten wir weiter ausbauen und die Fördermechanismen anpassen. Die Förderung der Musikschulen werden wir stabilisieren. Eine Überarbeitung der Förderrichtlinie Kulturelle Bildung ist daher dringend erforderlich. So stärken wir die Einrichtungen nicht nur in ihrem Auftrag der kulturellen Bildung, sondern entwickeln sie auch weiter als Orte des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es ist dringend notwendig das landesweite Konzept „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“ von 2018 fortzuschreiben. Landesprogramme und Projekte, die sich in diesem Bereich besonders bewährt haben, lassen sich in diesem Prozess festigen. Unser Ziel ist es, hohe Standards für die kulturelle Bildung zu halten und ein gutes Gleichgewicht von Beständigkeit und Erneuerung herzustellen. Diese Dynamik muss sich auch in einem zukünftigen Kulturraumgesetz abbilden. Die anstehende Evaluation und eine sich daraus ergebende Novellierung sollte daher auch Aspekte der kulturellen Bildung und ihrer flächendeckenden Wirkung sowie eine Verstetigung und dauerhafte Finanzierung der Netzwerkstellen „Kulturelle Bildung” im Blick haben.
-
BSW
Die zentrale Herausforderung dieses Themas besteht in der Ausgewogenheit. Die drei größeren Städte brauchen da wenig Hilfe: hier gibt es eine hohe Dichte an Institutionen kultureller Bildung resp. an Initiativen und Projekten kultureller Bildung aus den Institutionen – Theatern, Orchestern, Bibliotheken, Museen, Soziokulturellen Zentren – heraus. Im ländlichen Raum hingegen gibt es einerseits eine deutliche Unterversorgung an all den genannten Punkten, daneben aber durchgehend, besonders aber für Kinder und Jugendliche, ein Erreichbarkeitsproblem. Die mangelnde Erreichbarkeit der Kultureinrichtungen vor allem in den Abendstunden und vor allem für diejenigen, die nicht auf ein Auto zurückgreifen können, generiert eine gravierende Benachteiligung und eine Einschränkung der Lebensqualität. Hier müssen über die ohnehin nötige Verbesserung des ÖPNV in ländlichen Regionen zusätzlich Fördermöglichkeiten, z.B. für den Theater- oder Museumsbesuch von Schulklassen außerhalb des Schulbusverkehrs, geschaffen werden.
-
Bündnis 90/ Die Grünen
Kulturelle Bildung muss in Sachsen als Querschnittsaufgabe vorangebracht werden. Deshalb wollen wir, dass die zuständigen Ministerien ihre Zusammenarbeit intensivieren, um eine übergreifende Förderstrategie für die kulturelle Bildung zu entwickeln und umzusetzen. Das Landeskonzept „Kulturelle Bildung“ werden wir in einem umfassenden Beteiligungsprozess überarbeiten und mit konkreten Maßnahmen untersetzen. Wir werden Strukturen stärken, von den Musikschulen und ihren Kooperationsprojekten mit Schulen im Bereich Musik-, Tanz- und Gesangspädagogik, über den flächendeckenden Ausbau von Jugendkunstschulen bis zu den Soziokulturellen Zentren. Wir wollen die Förderbedingungen und Verstetigungschancen für landesweit bedeutende Maßnahmen verbessern und die Netzwerkstellen Kulturelle Bildung strukturell absichern, indem wir sie verbindlich im Kulturraumgesetz verankern. Ziel ist es, eine landesweite Koordinationsstelle für kulturelle Bildung zu schaffen, um die verschiedenen Beteiligten zu vernetzen und effektive Maßnahmen zu koordinieren. Die Verzahnung von Schule und Kultur ist auf allen Ebenen voranzubringen. Die Kapazitäten für Beratungs- und Steuerungsleistungen im Kultusministerium und im Landesamt für Bildung und Schule (LaSuB) sollen ausgebaut werden. Für stabile Kooperationen von Schulen und außerschulischen Partner*innen vor Ort und die alltägliche Einbindung kultureller Bildung in Ganztagsangeboten (GTA) und an außerschulischen Lernorten wollen wir Fachberatung und Qualifizierung für sich spezialisierende Lehrkräfte und Kulturschaffende etablieren. Die Verankerung kultureller Bildung in Schule und die Stärkung musischer Fächer ist für uns Bestandteil der Weiterentwicklung des sächsischen Bildungssystems.
-
DIE LINKE
Der Zugang zur kulturellen Bildung muss niederschwellig sein. Es dürfen weder das Einkommen, die kulturelle Herkunft oder der Wohnort Hindernisse sein. Wir setzen uns für einen kostenfreien ÖPNV ein, für kostenfreie Ganztagsangebote im Kulturbereich sowie kostengünstige Angebote der außerschulischen Bildung. Dies sehen wir beispielsweise durch:
-
- Partizipative Projekte in der kulturellen Bildung, in der sozial benachteiligte und marginalisierte Gruppen aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden und deren Perspektiven berücksichtigt werden.
- Barrierefreie und digitale Angebote für alle Menschen in Sachsen
- Evaluation und Qualitätssicherung im Austausch mit den Rezipienten, um den Wirkungsgrad kultureller Angebote stetig zu verbessern.
Durch diese Maßnahmen stellen wir sicher, dass kulturelle Bildung als Instrument zur Förderung von individueller Entfaltung, kulturellen Kompetenzen und einer »Kul-tur für alle« genutzt wird, die die gesamte Bevölkerung anspricht und unterstützt. -
-
FDP
Wir Freie Demokraten sehen in der kulturellen Bildung eine enorme Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft. Bei der ausgewogenen Umsetzung der vielfältigen Aufgaben der kulturellen Bildung vertrauen wir auf unsere sächsischen Kulturschaffenden, welche wir durch vereinfachte Förderprogramme und auskömmliche Finanzierung des Freistaats unterstützen wollen. Darüber hinaus wollen wir den Zugang zur kulturellen Bildung verbessern, indem wir neben dem kostenfreien Museumsbesuch für Kinder und Jugendliche auch für Theater die Möglichkeit eines kostenfreien Besuchs für Kinder und Jugendliche prüfen. Zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses im Kinder- und Jugendbereich wollen wir private Musikschulen, die entsprechende Leistungskriterien erfüllen, ebenso wie öffentliche Musikschulen fördern.
Die Unbekannten. Symposium zur Repräsentation von Behinderung in der Kunst (Dresden, 04.12.2024, 10:00 – 18:00 Uhr)
Die sächsische Landesgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft ist Kooperationspartner des Symposiums „Die Unbekannten. Symposium zur Repräsentation von Behinderung in der Kunst“. Die Veranstaltung wird von der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich, Landesverband Soziokultur Sachsen e.V. gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden organisiert.
Das Symposium bietet einen Rahmen, um Repräsentationspraktiken von Behinderung zu hinterfragen und als Bereicherung für die eigene kuratorische Arbeit zu entdecken. Viele Kunstsparten blicken auf eine jahrhundertealte Tradition, in der Behinderung keine eigene Rolle spielt. Dadurch bleiben wichtige Perspektiven und Beiträge unbeachtet. Manches schlummert in Depots, manches wird systematisch ausgeschlossen und manches wird lediglich in Sonderformaten gezeigt. Dabei ist oft ein kuratorischer Blick vorherrschend, der Behinderung marginalisiert, exotisiert oder stigmatisiert.
- Homepage der Veranstaltung: https://www.inklusion-kultur.de/startseite/symposium-start/
Ziele und Arbeitsweisen
Ziel unserer Aktivitäten ist es, kulturpolitischen Themen und Problemfeldern Öffentlichkeit zu verleihen. Fachleute, Entscheider*innen und Multiplikator*innen sowie ein breites Publikum sollen durch die Debatten erreicht und in den Diskurs einbezogen werden.
Unsere Arbeit ist dann erfolgreich, wenn sie zur Information und Meinungsbildung von kulturell engagierten Personen, politischen Verantwortungsträger*innen, Künstler*innen und Kulturpublikum beiträgt.
Die Arbeitsweise der Gruppe verbindet ehrenamtliches Engagement mit dem Anspruch an eine professionelle inhaltlich-thematische Auseinandersetzung.
Schwerpunkt sind Themen, die ausgehend vom Kontext in Sachsen auch bundesweit sowie in anderen europäischen Ländern – insbesondere in den Ländern Osteuropas – von Interesse sin
Portrait
Die Landesgruppe Sachsen der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. steht für die Beschäftigung mit aktuellen kulturpolitischen Fragen, die sich insbesondere aus der praktischen oder theoretischen Arbeit oder dem persönlichen Interesses der Mitglieder ergeben
Sprecher*innenteam

Constanze Müller
Geschäftsführerin Kunstraum D21 Leipzig, Staatssekretärin im Bundesministerium für Blühende Landschaften

Marcus Heinke
Geschäftsführer Kulturförderungspaten Heinke & Otte GbR | Agentur für Kulturförderung, Projektleiter Kulturförderung bei Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit Chemnitz e.V., Projektmanager Capacity Building bei Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 Gmb

Matthias Franke
Referent der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich und Referent für Nachhaltigkeit im Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
Mitglieder der Landesgruppe im Bundesvorstand der KuPoGe

Dr. Christina Ludwig
Direktorin des Stadtmuseums Dresden

Ferenc Csák
Amtsleiter des Kulturbetriebes der Stadt Chemnitz